Mitgliederseite

„Der gute Wille“, so lautet Kants gegen den Konsequentialismus gerichtete These am Anfang der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (4:394,13-15), „ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zu Erreichung irgend eines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, d.i. an sich, gut“. Der Wille ist gut, wenn er vom praktischen Gesetz bestimmt wird, das in einer seiner Formulierungen lautet: „Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst“ (4:429,10-12). “Eine grundlegende Frage in einer ethischen Theorie ”, so bestimmt Allen Wood den Unterschied zwischen dem Konsequentialismus und Kant, “ist die Natur des fundamentalen Wertes und der Art der Entitäten, in denen dieser Wert sich findet. Viele ethische Theorien nehmen an, dass diese Entitäten Zustände sind, die als Folgen von Handlungen betrachtet werden […] der grundlegende Wert für die kantische Ethik ist nicht ein Zustand, sondern die Würde oder der absolute Wert der vernünftigen Natur als Zweck an sich selbst.” Aber von der Frage nach dem fundamentalen Wert sei die Frage nach der Methode der moralischen Überlegung zu unterscheiden. Allein daraus, dass der fundamentale Wert kein Zustand ist, „folgt nicht direkt, dass in der moralischen Überlegung die Wahl der Handlungen von etwas anderem abhängen muss als dem Wert der Zustände, die durch sie hervorgebracht werden“ .
Kriterium dafür, so lässt diese Überlegung sich verdeutlichen, ob ich den anderen als Zweck an sich selbst behandle, sind die Zustände, die ich durch meine Handlungen hervorbringe. Die positive Pflicht, die sich aus der Formel von der Menschheit als Zweck an sich selbst ergibt, ist die Zwecke anderer zu befördern. „Denn das Subjekt, welches Zweck an sich selbst ist, dessen Zwecke müssen, wenn jene Vorstellung bei mir alle Wirkung tun soll, auch, so viel wie möglich, meine Zwecke sein“ (4:430,24-27). Nach der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten ist fremde Glückseligkeit ein Zweck, der zugleich Pflicht ist (6:385,31f.). Auch für Kant, das zeigt diese Überlegung, sind die (beabsichtigten) Folgen für die sittliche Bewertung einer Handlung relevant. Diese Folgen sind Zustände: der Zustand, dass der andere seine Zwecke erreicht hat oder dass seine Neigungen erfüllt wurden. Wie aber unterscheidet die Pflicht, sich die fremde Glückseligkeit zum Zweck zu machen, sich dann noch von der utilitaristischen Forderung, zum größten Glück der größten Zahl beizutragen?
Auf einen ersten Unterschied wurde bereits hingewiesen. Es ist nicht der Zustand als solcher, dem der Wert zukommt, sondern der Zustand, weil und insofern er Zweck einer Person ist. Ich muss den Zweck des anderen zu meinem Zweck machen, weil es der Zweck eines Wesens ist, das Zweck an sich selbst ist.
Ein zweiter Unterschied liegt in dem idealen Endzustand, den das sittliche Handeln verwirklichen soll. Im Utilitarismus ist das die maximale Erfüllung der Neigungen, bei Kant ist es das Reich der Zwecke. Auch im Reich der Zwecke geht es, wie im Utilitarismus, um die Erfüllung der materialen Zwecke, welche die einzelnen vernünftigen Wesen sich setzen. Aber diese Zwecke als solche sind kein letzter Gesichtspunkt; sie unterliegen vielmehr einer Einschränkung. Ein Reich ist „die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinsame Gesetze“ (4:433,17f.). Das sittliche Ideal ist „ein Ganzes aller Zwecke […] in systematischer Verknüpfung“ (4:433,21-24). Der Erfüllung der Zwecke ist die Frage nach der Vereinbarkeit der Zwecke vorgeordnet; nur die miteinander zu vereinbarenden Zwecke können den Anspruch erheben, erfüllt zu werden. In diesem Sinne gibt es gültige und nicht gültige Zwecke, und es sind „Gesetze“, welche „die Zwecke ihrer allgemeinen Gültigkeit nach bestimmen“ (4:433,19).
Besteht nach Kant jede moralische Überlegung, so ist drittens zu fragen, zumindest auch in einer Bewertung der Folgen? Wenn ich Wood richtig verstanden habe, ist das seine Interpretation; allein daraus, dass der fundamentale Wert kein Zustand ist, „folgt nicht direkt, dass in der moralischen Überlegung die Wahl der Handlungen von etwas anderem abhängen muss als dem Wert der Zustände, die durch sie hervorgebracht werden“ . Dagegen spricht Kants Begründung des Verbots der Lüge in der Tugendlehre, die ausdrücklich betont, dass der Schaden, der anderen oder dem Lügner selbst aus der Lüge entsteht, nicht der eigentliche Grund für die sittliche Verwerflichkeit sei. Die Lüge ist „die größte Verletzung der Pflicht des Menschen gegen sich selbst“ (6:429,4); sie ist „Wegwerfung und gleichsam Vernichtung seiner Menschenwürde“ (6:429,23f.). Der Schaden, der anderen Menschen daraus entstehen kann, betrifft „nicht das Eigentümliche des Lasters“, denn dann „bestände es bloß in der Verletzung der Pflicht gegen andere“, und ebenso wenig der Schaden, „den er sich selbst zuzieht, denn alsdann würde es bloß, als Klugheitsfehler, der pragmatischen, nicht der moralischen Maxime widerstreiten, und gar nicht als Pflichtverletzung angesehen werden können“ (6:429,17-23).
II.
„Jeder Mensch “, so die programmatische Aussage in John Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit (1971), „besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletztlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann.“ Die Theorie der Gerechtigkeit ist unter zweifacher Rücksicht ein Wendepunkt in der moralphilosophischen Diskussion: in der Abkehr vom Utilitarismus und der Hinwendung zur kantischen Tradition, und in der Rückkehr von der metaethischen Diskussion zu inhaltlichen Fragen der Moral. Rawls bezieht sich in der Theorie der Gerechtigkeit ausdrücklich auf Kant. Er wendet sich gegen die einseitige Betonung der Formel vom allgemeinen Gesetz, wie sie in der Diskussion über die Universalisierbarkeit als Kriterium moralischer Normen deutlich wird, und beruft sich stattdessen auf Kants Begriff der Autonomie. Ich möchte hier eingehen auf Rawls‘ Kant-Interpretation in seinen Lectures on the History of Moral Philosophy (1991), und zwar auf seine Interpretation der Methode Kants, die Rawls als „Moral Constructivism“ bezeichnet.
Der Kategorische Imperativ ist ein Verfahren, durch das die inhaltlichen Rechts- und Tugendpflichten erzeugt werden. Rawls vergleicht Kants Konstruktivismus in der Moralphilosophie mit dem in der Mathematik. „Die Idee ist, dass Urteile gültig und gesund sind, wenn sie aus der Befolgung eines korrekten Verfahrens resultieren und auf wahren Prämissen beruhen“ (238). Konstruiert werden die einzelnen inhaltlichen kategorischen Imperative. Das Verfahren selbst wird nicht konstruiert, sondern lediglich expliziert. „Kant glaubt, dass unser alltägliches menschliches Verstehen sich implizit der Forderungen der praktischen Vernunft bewusst ist, sowohl der reinen als auch der empirischen” (239).
Der Kategorische Imperativ ist ein Konstruktionsverfahren. Dieses Konstruktionsverfahren ist nicht selbst konstruiert; es ist vielmehr die Explikation unseres alltäglichen moralischen Bewusstseins. Dieses alltägliche Bewusstsein hat ein Fundament, und dieses Fundament „spiegelt sich“ im Verfahren des Kategorischen Imperativs. Es ist „die Vorstellung von freien und gleichen Personen als vernünftig und rational“ (240). “Dass wir sowohl vernünftig als auch rational sind, spiegelt sich in der Tatsache, dass das Verfahren des Kategorischen Imperativs beide Formen des Denkens einschließt“ (240). Wir sind rational, weil wir uns Zwecke setzen und überlegen, auf welchem Weg wir sie erreichen können. “Es heißt aber auch, dass wir vernünftig sind, denn wenn wir nicht durch das Vernünftige bewegt würden, würden wir nicht, wie Kant es nennt, ein reines praktisches Interesse daran nehmen, unsere Maximen nach dem vorgeschriebenen Verfahren zu prüfen“ (240f.).
Die Grundlage von Kants Konstruktivismus ist sein Begriff der Person “zusammen mit der Vorstellung einer Gesellschaft aus solchen Personen, deren jede ein gesetzgebendes Glied in einem Reich der Zwecke ist” (240). Diese Vorstellungen sind nicht konstruiert und sie werden nicht ausgelegt; sie haben vielmehr ihren Ursprung in unserer moralischen Erfahrung; sie sind in unserem alltäglichen moralischen Bewusstsein enthalten. „Es ist für Kants Lehre charakteristisch, dass eine relativ komplexe Vorstellung der Person bei der Ausarbeitung des Konzepts seiner Sicht der Moral eine zentrale Rolle spielt“ (237). Der Konstruktivismus ist kein Subjektivismus; er bestreitet nicht die Objektivität moralischer Urteile. Ein moralisches Urteil ist richtig, wenn es den Kriterien der Vernünftigkeit und Rationalität entspricht, wie sie im Verfahren des Kategorischen Imperativs miteinander verbunden sind. Ein solches Urteil wird von jeder vollständig vernünftigen, rationalen und informierten Person anerkannt werden. Eine Konzeption der Objektivität muss erklären können, worauf diese unsere Übereinstimmung in Urteilen beruht. Kant erklärt sie durch unsere Teilhabe an einer gemeinsamen praktischen Vernunft. Vernünftige und rationale Personen müssen mehr oder weniger dieselben Gründe anerkennen und ihnen mehr oder weniger dasselbe Gewicht geben. „Zu sagen, dass eine moralische Überzeugung objektiv ist, bedeutet dann zu sagen, dass es Gründe gibt, die hinreichen, um alle vernünftigen Personen zu überzeugen, dass sie gültig und richtig ist. Ein moralisches Urteil zu fällen bedeutet, implizit zu behaupten, dass es solche Gründe gibt und dass das Urteil vor einer Gemeinschaft von solchen Personen gerechtfertigt werden kann“ (245).
III.
Stephen Darwall vergleicht zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ich gegenüber einem anderen Menschen begründen kann, er solle aufhören, mir weh zu tun, z.B. er solle nicht länger auf meinem Fuß stehen. (a) Ich kann ihm sagen, die Tatsache, dass ich Schmerzen habe, sei ein schlechter Zustand der Welt und folglich habe er einen Grund, diesen Zustand zu ändern. Die Welt wäre besser, wenn ich keine Schmerzen hätte. Wenn ich ihm in dieser Weise eine Begründung gebe, so unterscheidet Darwall, gebe ich ihm weniger eine praktische als vielmehr eine epistemische Anweisung. Ich fordere ihn auf, einen Zustand der Welt zu sehen und ihn mit einem anderen Zustand zu vergleichen. Ich gehe nicht ein auf die Beziehungen zwischen ihm und mir; es geht vielmehr um die Auswirkungen seines Verhaltens auf den Zustand der Welt. (b) Ich sage ihm etwas, das meine Autorität geltend macht, aufgrund derer ich von ihm verlangen kann, dass er seinen Fuß von meinem wegnimmt. Ich verlange es als die Person, auf deren Fuß er steht. Der Grund, den ich in diesem Fall anführe, betrifft seine Beziehung zu anderen; dass er auf meinem Fuß steht, verursacht mir, einer anderen Person, Schmerzen. Dieser Grund richtet sich nicht an ihn als jemand, der einen besseren Zustand der Welt herbeiführen kann. Er richtet sich vielmehr an ihn „als die Person, die unnötig einer anderen Person Schmerz zufügt, etwas, bei dem wir normalerweise annehmen, dass wir die Autorität haben zu verlangen, dass Personen es nicht einander antun“ (7).
Wenn ich in der ersten Weise argumentiere, könnte die Person, die auf meinem Fuß steht, antworten: Durch das abschreckende Beispiel, dass ich fest auf deinem Fuß stehe, bringe ich zehn andere Personen dazu, dass sie aufhören, anderen Personen unnötige Schmerzen zuzufügen; und eine Welt mit zehn Personen ohne unnötige Schmerzen ist besser als eine Welt mit einer Person ohne unnötige Schmerzen. Ich könnte den Verrat einer unschuldigen Person dadurch rechtfertigen, dass ich sage, ich würde dadurch den Verrat von zehn anderen unschuldigen Personen verhindern. So zu argumentieren widerspricht unseren moralischen Intuitionen. Unsere Intuitionen sagen: Das moralische Urteil über deine Handlung hängt nicht nur von deren Folgen ab, d.h. es ist nicht agent neutral; es hängt ebenso von der Frage ab, ob du das Übel verursacht hast oder eine andere Person, d.h. es ist agent relative. Wenn ich also einen moralischen Grund dafür anführen will, dass die andere Person ihren Fuß von meinem Fuß wegnehmen soll, muss ich in der zweiten Weise argumentieren. Moralische Gründe „sind ihrem Wesen nach relational; worum es geht ist nicht, wie zu sein für die Welt gut sein würde, oder sogar welche Arten von Handlungen aufgrund ihrer inneren Natur gefordert sind, sondern wie wir uns gegeneinander verhalten sollen“ (38).
Wie können wir diese Intuitionen analysieren und rekonstruieren? Was sind die Voraussetzungen und was ist die Struktur der zweiten Art des Argumentierens? Darwall nennt einen Handlungsgrund der zweiten Art einen persönlichen Grund in der zweiten Person. Was einen Grund zu einem persönlichen Grund in der zweiten Person macht ist, dass er auf den (de jure) Autoritätsbeziehungen beruht, die, wie der Sprecher annimmt, zwischen ihm und seinem Adressaten bestehen“ (4). Der moralische Standpunkt ist der Standpunkt der zweiten Person: „die Perspektive, die du und ich einnehmen, wenn wir Ansprüche an gegenseitiges Verhalten und Wollen stellen und anerkennen“ (3). Zweitpersönliche Gründe an jemand zu richten „bringt immer bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der Autorität der zweiten Person, der Kompetenz und Verantwortung des Sprechers ebenso wie des Adressaten mit sich […] ein Sprecher versucht einem Adressaten einen Grund zum Handeln zu geben, der auf normativen Beziehungen beruht, von denen […], wie er voraussetzt, erwartet werden kann, dass der Adressat sie akzeptiert“ (20).
Als freie und verantwortliche Personen adressieren wir an einander Gründe zum Handeln. Aber wie sind diese Gründe genauer zu bestimmen? Darwalls Standpunkt der zweiten Person ist ein kontraktualistischer Ansatz. Die Würde der Person verpflichtet uns, unser Verhalten durch Grundsätze zu regeln, die jeder als frei und vernünftig Handelnder akzeptieren kann oder nicht vernünftigerweise zurückzuweisen braucht. „Um eine Forderung an jemand als freies und vernünftiges Wesen zu richten, muss man voraussetzen, dass die Person sich durch eben diese Forderung selbst frei bestimmen kann, dass die Forderung eine ist, die sie, als frei und vernünftig, akzeptieren kann oder nicht vernünftigerweise zurückzuweisen braucht und die sie deshalb sich zu eigen machen kann“ (306).
Der Kontraktualismus ist eine Interpretation von Kants Formel des Reichs der Zwecke. Jedes vernünftige Wesen muss „sich durch alle Maximen seines Willens als allgemein gesetzgebend betrachten“ (Grundlegung, 4:433,12f.). „Wir haben eine gleiche Stellung, nicht nur beim Befolgen und Geltendmachen des moralischen Gesetzes (was auch immer sein Inhalt ist), sondern auch beim ‚Bestimmen‘ seines Inhalts“ (307). Die Gesetze des Reichs der Zwecke sind auch in dem Sinn „gemeinschaftliche Gesetze“ (4:433,18), dass jede Person am Prozess der Gesetzgebung beteiligt ist. Der Kontraktualismus interpretiert Kants Idee nicht als tatsächliche Bestimmung dieser Gesetze durch konkrete Personen, sondern als deren Bestimmung durch einen hypothetischen, idealisierten Prozess der Übereinstimmung von freien und vernünftigen Personen als solchen, z.B. hinter einem Schleier des Nichtwissens der individuellen Unterschiede.
Was ist der Inhalt der Gesetze, denen vernünftige Wesen in dieser idealen Situation zustimmen? Welche Interessen haben Individuen als Glieder des Reichs der Zwecke, die sie durch Gesetze, welche sie in dieser idealen Situation geben, schützen wollen? Vernünftige Wesen, so Kants Antwort, wollen ihre Würde bewahren. Sie betrachten notwendig, so interpretiert Thomas E. Hill, Jr., „ihre «vernünftige Natur » als «Zweck an sich selbst », und das impliziert, das sie der Verwirklichung dieser Dispositionen absolute Priorität geben gegenüber dem Erreichen verschiedener kontingenter Ziele, wenn es zu einem Konflikt zwischen diesen beiden Werten («Würde» und «Preis») kommt“ . Sie betrachten ihre Fähigkeit, vernünftig handeln zu können, als Zweck an sich selbst. „Das heißt, die Fähigkeit vernünftig handeln zu können zu bewahren und zu achten, ist ein zentrales Ziel der Gesetzgeber des Reichs der Zwecke, und das hat im Fall eines Konflikt eine höhere Priorität als die Beförderung der verschiedenen Zwecke, welche die Glieder sich zu eigen machen mögen.“
IV.
1958 erschien G.E.M. Anscombes Aufsatz Modern Moral Philosophy und 1964 die erste vollständige englische Übersetzung von Kants Metaphysik der Sitten. Diese beiden Daten markieren den Beginn einer neuen Sicht auf Kants Moralphilosophie. Anscombe fordert, an die Stelle einer Sollens- oder Gesetzesethik solle eine Tugendethik treten. Die gegenwärtige Tugendethik, die sich als Gegenposition zur Kantischen Ethik versteht, stellt für die Kantforschung eine Herausforderung dar, sich mit der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten zu beschäftigen, um Kants Moralphilosophie gegen die Kritik seitens der Vertreter der Tugendethik zu verteidigen.
Das Ergebnis dieser Diskussion ist, dass Kants Ethik in einem neuen Licht erscheint. Vorher war das verbreitete Bild von der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und der Analytik der zweiten Kritik bestimmt, und von den verschiedenen Formeln des Kategorischen Imperativs stand die Formel vom allgemeinen Gesetz im Mittelpunkt des Interesses. Hervorstechende Züge dieses Bildes sind: der Gegensatz von praktischer Vernunft und unterem Begehrungsvermögen; der daraus sich ergebende Gegensatz zwischen materialen praktischen Prinzipien und bloß formalen Gesetzen; die Universalisierbarkeit als Kriterium der moralischen Beurteilung von Maximen und der Eindruck, dass damit die Tätigkeit der praktischen Vernunft erschöpfend charakterisiert sei. Wie wird dieses Bild durch die Beschäftigung mit der Metaphysik der Sitten korrigiert und ergänzt? Ich möchte auf vier Akzente hinweisen.
1. Tugend ist ein Thema der kantischen Moralphilosophie. Kant entwickelt den Begriff der Tugend, indem er vom Gegensatz zwischen Pflicht und Neigung ausgeht. „Tugend ist die Stärke der Maxime des Menschen in der Befolgung seiner Pflicht. – Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann; bei der Tugend aber sind diese die Naturneigungen, welche mit dem sittlichen Vorsatz in Streit kommen können […Tugend ist] ein Zwang nach einem Prinzip der innern Freiheit, mithin durch die bloße Vorstellung seiner Pflicht nach dem formalen Gesetz derselben“ (6:394,15-23). Tugend ist das “moralische Vermögen” zum “Selbstzwang” (6:394,27f.). “Alle Pflichten enthalten den Begriff der Nötigung durch das Gesetz; die ethische eine solche, wozu nur eine innere, die Rechtspflichten dagegen eine solche Nötigung, wozu auch eine äußere Gesetzgebung möglich ist“ (6:394,24-27).
Mit der Tradition bestimmt Kant die Tugend als habitus (“Fertigkeit”); Fertigkeit “ist eine Leichtigkeit zu handeln und eine subjective Vollkommenheit der Willkür” (6:407,5f.). Kant unterscheidet beim habitus zwischen “Angewohnheit” und “freier Fertigkeit” (habitus libertatis). Tugend ist keine Angewohnheit. Sie ist „die Fertigkeit in freien gesetzmäßigen Handlungen“, aber man sie nicht dadurch definieren. Diese Bestimmung bedarf vielmehr der Ergänzung: Tugend ist die Fertigkeit in freien gesetzmäßigen Handlungen „sich durch die Vorstellung des Gesetzes im Handeln zu bestimmen“. Diese Fertigkeit ist nicht eine Beschaffenheit der Willkür, d.h. des Vermögens „nach Belieben zu tun oder zu lassen“ (6:213,16f.), sondern des Willens, d.h. des Begehrungsvermögens, insofern es die Willkür zur Handlung bestimmen kann. Der Wille ist ein „allgemein-gesetzgebendes Begehrungsvermögen“ (6:407,16f.), und Tugend ist dessen „Fertigkeit“ oder „Leichtigkeit“ (6:407,5), sein „Gesetz in Ausübung zu bringen“ (6:409,9f.)., d.h. die Willkür zu bestimmen.
Tugend muss erworben werden. Man kann nicht sofort alles, was man will; vielmehr muss man zuvor seine Kräfte üben. Die sittliche Maxime gewinnt ihre Kraft im Streit mit den ihr entgegenstehenden Neigungen. Tugend „ist das Produkt aus der reinen praktischen Vernunft, sofern diese im Bewusstsein ihrer Überlegenheit (aus Freiheit) über jene die Obermacht gewinnt“ (6:477,10-12). Die Übung der Tugend hat zum Ziel, „wackeren und fröhlichen Gemüts (animus strenuus et hilaris) in der Befolgung ihrer Pflichten zu sein“. Sie muss mit Hindernissen kämpfen und manche Lebensfreuden opfern, was das Gemüt bisweilen finster und mürrisch machen kann; „was man aber nicht mit Lust, sondern bloß aus Frohndienst tut, das hat für den, der hierin seiner Pflicht gehorcht, keinen inneren Wert und wird nicht geliebt“. Zur Haltung der Stoiker, die Übel des Lebens zu ertragen und die überflüssigen Genüsse zu entbehren, „muss etwas dazu kommen, was einen angenehmen Lebensgenuss gewährt und doch bloß moralisch ist. Das ist das jederzeit fröhliche Herz in der Idee des tugendhaften Epikurs“ (6:484,21-485,5).
2. Mit dem Tugendbegriff ist das Thema Vernunft und Gefühl, Pflicht und Neigung angesprochen, aber nicht erschöpft. Tugend ist die Kraft des Willens in der Auseinandersetzung mit den dem Sittengesetz entgegenstehenden Neigungen. Aber Kant spricht auch von Neigungen, die der Erfüllung des Sittengesetzes entgegenkommen, und er weiß, dass Neigungen geformt und kultiviert werden können.
Das Bewusstsein der Pflicht beruht auf einem Gefühl. Kant kennt ein moralisches Gefühl, das die subjektive Bedingung der Empfänglichkeit für den Pflichtbegriff ist; ohne dieses Gefühl könnten wir uns der Pflicht nicht bewusst werden. Das moralische Gefühl ist „die Empfänglichkeit für Lust und Unlust bloß aus dem Bewusstsein der Übereinstimmung oder des Widerstreits unserer Handlungen mit dem Pflichtgesetze“. Es ist eine notwendige Bedingung für die Bestimmung der Willkür. „Alle Bestimmung der Willkür aber geht von der Vorstellung der möglichen Handlung durch das Gefühl der Lust oder Unlust, an ihr oder ihrer Wirkung ein Interesse zu nehmen, zur Tat“. Es kann keine Pflicht geben, ein moralisches Gefühl zu haben, „denn alles Bewusstsein der Verbindlichkeit legt dieses Gefühl zum Grunde, um sich der Nötigung, die im Pflichtbegriffe liegt, bewusst zu werden: sondern ein jeder Mensch (als moralisches Wesen) hat es ursprünglich in sich; die Verbindlichkeit aber kann nur darauf gehen, es zu kultivieren und selbst durch die Bewunderung seines unerforschlichen Ursprungs zu verstärken“ (6:399,19-400,1).
Die regelmäßige Erfüllung der Pflicht hat, wie Kant am Beispiel der Liebespflicht zeigt, Gefühle zur Folge, die diese Erfüllung unterstützen. „Liebe ist eine Sache der Empfindung, nicht des Wollens, und ich kann nicht lieben, weil ich will, noch weniger aber, weil ich soll […]. Wohlwollen (amor benevolentiae) aber kann als ein Tun einem Pflichtgesetz unterworfen sein” (6:401,24-28). „Wohltun ist Pflicht. Wer diese oft ausübt, und es gelingt ihm mit seiner wohltätigen Absicht, kommt endlich wohl gar dahin, den, welchem er wohlgetan hat, wirklich zu lieben. Wenn es also heißt: du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst, so heißt das nicht: du sollst unmittelbar (zuerst) lieben und vermittelst dieser Liebe (nachher) wohltun, sondern: tue deinem Nebenmenschen wohl, und dieses Wohltun wird Menschenliebe (als Fertigkeit der Neigung zum Wohltun überhaupt) in dir bewirken!“ (6:402,14-21). Es ist eine indirekte Pflicht, mitleidige natürliche Gefühle in uns zu kultivieren, denn das schmerzhafte Mitgefühl ist „einer der in uns von der Natur gelegten Antriebe […], dasjenige zu tun, was die Pflichtvorstellung für sich allein nicht ausrichten würde“ (6:457,33-35).
3. Die Metaphysik der Sitten zeichnet ein differenziertes Bild von den Aufgaben der praktischen Vernunft. Die ethischen Pflichten unterscheiden sich von den Rechtspflichten dadurch, dass das Sittengesetz nur die Maxime der Handlungen und nicht die Handlungen selbst gebieten kann. Die beiden Zwecke, die das Sittengesetz gebietet, sind die eigene Vollkommenheit und die fremde Glückseligkeit; es sind Zwecke, die zugleich Pflicht sind. Diese Zwecke lassen es offen, in welchem Ausmaß und durch welche Handlungen sie verwirklicht werden sollen; es bleibt also bei der Befolgung der Tugendpflichten für die freie Willkür ein „Spielraum (latitudo)“ (6:390,6f.). Die Tugendpflichten schränken einander ein; die Zeit und Kraft, die ich auf die Wohltätigkeit verwende, kann ich nicht zugleich auf die Kultur meiner Vermögen verwenden; ich muss entscheiden, welches der „stärkere Verpflichtungsgrund“ (6:224,25) ist.
Wegen dieses weiten Spielraums ist die praktische Vernunft in der Tugendlehre vor Fragen gestellt, welche die Rechtslehre, die es mit lauter engen Pflichten zu tun hat, d.h.die bestimmte Handlungen vorschreibt, nicht kennt. „Die Ethik […] führt wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen Pflichten verstattet, unvermeidlich dahin, zu Fragen, welche die Urteilskraft auffordern auszumachen, wie eine Maxime in besonderen Fällen anzuwenden sei […]; und so gerät sie in eine Kasuistik, von welcher die Rechtslehre nichts weiß“ (6:411,10-17). Die Kasuistik ist eine Übung, wie die Wahrheit gesucht werden soll. Das praktische Urteil muss entscheiden, welcher Verpflichtungsgrund stärker ist; so wird z.B. die Pflicht zur allgemeinen Nächstenliebe durch die Elternliebe eingeschränkt (6:390,12).
Die Tugendpflichten gegen andere sind die Pflicht zur Liebe und die Pflicht zur Achtung. Sie sind “im Grunde dem Gesetze nach jederzeit mit einander in einer Pflicht zusammen verbunden“ (6:448,19f.). Ich erfülle die Pflicht der Liebe nicht, wenn ich nicht zugleich die Pflicht der Achtung erfülle; die Pflicht der Liebe wird durch die Pflicht der Achtung eingeschränkt. „So werden wir gegen einen Armen wohltätig zu sein uns für verpflichtet erkennen; aber weil diese Gunst doch auch Abhängigkeit seines Wohls von meiner Großmut enthält, die doch den Anderen erniedrigt, so ist es Pflicht, dem Empfänger durch ein Betragen. welches diese Wohltätigkeit entweder als bloße Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die Demütigung zu ersparen und ihm seine Achtung für sich selbst zu erhalten“ (6:448,22-449,2). Kant vergleicht diese beiden Pflichtgesetze mit den Naturgesetzen der Anziehung und Abstoßung. „Vermöge des Prinzips der Wechselliebe sind sie angewiesen sich einander beständig zu nähern, durch das der Achtung, die sie einander schuldig sind, sich im Abstande von einander zu erhalten“ (6:449,8-11). Die Aufgabe der praktischen Vernunft besteht darin, das richtige Verhältnis zwischen diesen beiden Kräften zu finden, d.h. diese beiden Forderungen miteinander in Einklang zu bringen.
Von den ethischen Pflichten der Menschen als solcher gegeneinander unterscheidet Kant die ethischen Pflichten der Menschen gegeneinander in Ansehung ihres Zustandes. Sie sind kein eigentlicher Teil der metaphysischen Anfangsgründe der Tugendlehre, sondern Regeln, die das Tugendprinzip auf die Erfahrung anwenden. Wie „von der Metaphysik der Natur zur Physik ein Überschritt, der besondere Regeln hat, verlangt wird: so wird der Metaphysik der Sitten ein Ähnliches mit Recht angesonnen: nämlich durch Anwendung auf die Erfahrung jene gleichsam zu schematisieren und zum moralisch-praktischen Gebrauch fertig darzulegen.- Welches Verhalten also […] nach Verschiedenheit der Stände, des Alters, des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des der Wohlhabenheit oder Armut u.s.w. zukomme: das gibt nicht so vielerlei Arten der ethischen Verpflichtung […], sondern nur Arten der Anwendung […] ab“ (6:468,27-469,8). Aber diese Anwendung gehört zur Vollständigkeit der Darstellung der Metaphysik der Sitten.
4. Die vollkommene Erfüllung der Pflichten der gegenseitigen Liebe und Achtung führt zu einer idealen Form der menschlichen Gemeinschaft: der Freundschaft. „Freundschaft (in ihrer Vollkommenheit betrachtet) ist die Vereinigung zweier Personen durch gleiche wechselseitige Liebe und Achtung“. Vollkommene Freundschaft ist nur eine Idee, aber sie ist eine praktisch notendige Idee, und nach Freundschaft zu streben ist eine „von der Vernunft aufgegebene“ Pflicht (6:469,17-28). Dass es Pflicht ist, nach Freundschaft zu streben, folgt daraus, dass Freundschaft die vollkommene Erfüllung der beiden Tugendpflichten gegen andere ist. Durch die Erfüllung der Pflicht macht der Mensch sich glückswürdig; zugleich trägt die Freundschaft zum Glück des Lebens bei.
Dass die vollkommene Freundschaft eine “bloße” Idee ist, ergibt sich aus folgendem Zusammenhang: Wenn ein Freund gegenüber seinem Freund eine Liebespflicht erfüllt, dann sieht der andere darin einen Mangel an Achtung. „Moralisch erwogen, ist es freilich Pflicht, dass ein Freund dem anderen seine Fehler bemerklich mache; den das geschieht ja zu seinem Besten, und es ist also Liebespflicht. Seine andere Hälfte aber sieht hierin einen Mangel an Achtung, die er von jenem erwartete“ (6:470,21-24). „Wenn aber einer von dem andern eine Wohltat annimmt, so kann er wohl vielleicht auf Gleichheit in der Liebe, aber nicht in der Achtung rechnen, denn er sieht sich offenbar eine Stufe niedriger, verbindlich zu sein und nicht gegenseitig verbinden zu können“ (6:471,6-10).
Von der vollkommenen unterscheidet Kant die moralische Freundschaft. Sie ist „das völlige Vertrauen zweier Personen in wechselseitiger Eröffnung ihrer geheimen Urteile und Empfindungen, so weit sie mit beiderseitiger Achtung gegen einander bestehen kann” (6:471,27-29). Die moralische Freundschaft ist ausschließlich ein Verhältnis gegenseitiger Achtung; es geht nicht um eine Teilnahme an den Zwecken und am Wohl des anderen. Der Mensch hat ein Bedürfnis, sich anderen zu eröffnen, und zugleich fürchtet er den Missbrauch. „Der Mensch ist ein für die Gesellschaft bestimmtes (obzwar doch auch ungeselliges) Wesen, und in der Kultur des gesellschaftlichen Zustandes fühlt er mächtig das Bedürfnis, sich anderen zu eröffnen […]; andererseits aber auch durch die Furcht vor dem Missbrauch, den andere von dieser Aufdeckung seiner Gedanken machen dürften, beengt und gewarnt sieht er sich genötigt, einen guten Teil seiner Urteile (vornehmlich über andere Menschen) in sich selbst zu verschließen“ (6:471,30-472,1).
In der bloß moralischen Freundschaft kann der oben beschriebene Konflikt zwischen Liebe und gegenseitiger Achtung nicht aufkommen; die Liebespflicht beschränkt sich hier darauf, dem Bedürfnis des Menschen, sich anderen zu eröffnen, entgegen zu kommen. Diese bloß moralische Freundschaft ist nicht lediglich ein Ideal, „sondern (der schwarze Schwan) existiert wirklich hin und wieder in seiner Vollkommenheit“ (6:472,26f.). Sie ist Pflicht, weil das Ideal der Freundschaft nur in ihr verwirklicht werden kann. Sie gehört zum Glück des Lebens; in ihr kann der Mensch “seinen Gedanken Luft machen; er ist mit seinen Gedanken nicht völlig allein, wie im Gefängnis, und genießt eine Freiheit, der er in dem großen Haufen entbehrt, wo er sich in sich selbst verschließen muss” (6: 472,11-14). Die moralische Freundschaft ist nur unter zwei Voraussetzungen möglich. Die erste ist die gegenseitige Achtung. Die Freunde eröffnen einander auch ihre Fehler, und jeder von ihnen muss darauf vertrauen können, dass der andere dieses Wissen nicht missbraucht. Die zweite Voraussetzung ist das Urteilsvermögen; der Freund muss darauf vertrauen können, dass sein Freund unterscheiden kann, was er von dem, was der Freund ihm eröffnet hat, anderen mitteilen darf und was nicht.
Die Tugend, so der Sokrates der Apologie, ist Ursache aller anderen Güter. Das Beispiel aus dem ersten Buch der Politeia führt uns zu den Prämissen dieser These. Die erste, an anderer Stelle ausgesprochene Prämisse ist, dass die Menschen sich die lebensnotwendigen Güter nur gemeinsam beschaffen können. Keiner „von uns kann sich selbst genügen, sondern jeder hat viele andere nötig“ (369b6f.). Gerechtigkeit, so die zweite Prämisse, ist notwendige Bedingung dafür, dass Menschen etwas gemeinsam verwirklichen können; nur sie schafft die dafür erforderliche Eintracht; Unrecht erzeugt Hass und Zwietracht. Zum Wesen des Men1 schen gehört ein Sinn für Gerechtigkeit; er zeigt sich darin, wie ein Mensch auf einen Schmerz, der ihm von einem anderen zugefügt wird, reagiert. Ist er sich bewusst, dass er selbst Unrecht getan hat und der Überzeugung, dieser Schmerz werde ihm mit Recht zugefügt, so wird er sich darüber nicht ereifern. „Wie aber, wenn einer glaubt, dass ihm Unrecht geschehe? Da kocht es doch in ihm, und er entrüstet sich und kämpft für das, was ihm gerecht scheint“ (440c7f.). Der Mensch, so Aristoteles in der Politik, ist das einzige Lebewesen, das Sprache besitzt. Die bloße Stimme, die auch die anderen Lebewesen haben, zeigt nur das Angenehme und Unangenehme an; „die Sprache (logos) dagegen ist dazu bestimmt, das Nützliche und Schädliche deutlich kundzutun und also auch das Gerechte und Ungerechte. Denn das ist eben dem Menschen eigentümlich im Gegensatz zu den Tieren, dass er allein eine Wahrnehmung (aisthêsis) von gut und schlecht, gerecht und ungerecht usw. hat“ (Pol.I 2,1253a1418). Die Erkenntnis des Gerechten und Ungerechten ist eine Folge de r Erkenntnis von Nutzen und Schaden; mit der Erkenntnis von Nutzen und Schaden ist notwendig die Frage verbunden, wie Nutzen und Schaden verteilt sind.
Die Wörter «Gerechtigkeit» und «Ungerechtigkeit» werden in mehrfacher Weise gebraucht, und Aristoteles geht in der Nikomachischen Ethik für seine Unterscheidungen von der Ungerechtigkeit aus; er fragt, wie viele Bedeutungen der Ausdruck «der Ungerechte» hat. „Als ungerecht gilt zum einen, wer das Gesetz verletzt, zum andern, wer mehr haben will, das heißt eine Einstellung der Ungleichheit hat. Daher ist klar, dass gerecht derjenige sein wird, der die Gesetze beachtet und eine Einstellung der Gleichheit hat. Das Gerechte ist also das Gesetzliche und das Gleiche, das Ungerechte das Gesetzwidrige und Ungleiche“ (NE V 2,1129a32-b1).
Alles, was den Gesetzen entspricht, ist in gewisser Weise gerecht. Die Gesetze regeln alle Lebensbereiche im Hinblick auf Nutzen und Schaden aller Betroffenen und der Gemeinschaft. So ergibt sich folgender Begriff der Gerechtigkeit: Wir „nennen gerecht in einer Weise das, was das Glück und seine Teile für die politische Gemeinschaft hervorbringt und erhält“ (NE V 3,1129b17-19). Die so verstandene Gerechtigkeit (iustitia legalis) ist nicht eine Tugend unter anderen; sie ist vielmehr die gesamte Tugend, insofern diese betrachtet wird in ihrer Beziehung auf den anderen Menschen. Aristoteles nennt sie „ein fremdes Gut [...], denn sie tut was einem anderen nützt“ (1130a3-5).
Als Teil der Tugend, d.h. als eine von den anderen unterschiedene Tugend, ist die Gerechtigkeit die richtige Einstellung zur Gleichheit; das Gerechte ist hier das Gleiche. Im Anschluss 2 an Aristoteles unterscheidet Thomas von Aquin hier zwei Arten: die iustitia distributiva, die verteilende Gerechtigkeit, und die iustitia commutativa, die Tauschgerechtigkeit (S.th. 2-2 q.61a.1). Bei der iustitia distributiva geht es, so Aristoteles, um die „Verteilung von Ehre, Geld oder anderen Gütern, die unter den Mitgliedern der Staatsgemeinschaft teilbar sind“ (NE V 5,1130b31f.); die iustitia commutativa fordert, dass der Wert der getauschten Güter derselbe ist.
Unter den Gütern, die gerecht zu verteilen sind, nennt Aristoteles an erster Stelle die Ehre (timê). Das Wort wird auch für die Staatsämter gebraucht. „Wir sagen, dass die Staatsämter Ehren sind“ (Pol.III 10,1281a31). Wie die Staatsämter zu verteilen sind, regelt die Verfassung (politeia); sie ist „die Ordnung des Staates in Bezug auf die Staatsämter und besonders in Bezug auf das oberste von allen“ (Pol.III 6,1278b9f.). Aristoteles unterscheidet zunächst zwischen richtigen und verfehlten Verfassungen. Richtige Verfassungen sind die, welche den gemeinsamen Nutzen, verfehlte Verfassungen dagegen die, welche nur den Nutzen der Regierenden im Auge haben. Es gibt drei richtige Verfassungen: zum gemeinsamen Nutzen regiert entweder ein einziger (Königtum) oder es regieren wenige (Aristokratie) oder es regiert die Mehrzahl (Politie).
Welche von diesen drei richtigen ist die beste Verfassung? Diese Frage ist vieldeutig. Sie kann auf die ideale, absolut beste Verfassung zielen, die allen Wünschen entspricht; um diese ideale Verfassung zu verwirklichen, müssen jedoch ideale äußere Bedingungen gegeben sein. Gegenstand der Frage kann aber auch die beste unter den gegebenen Umständen mögliche Verfassung sein. „Die meisten, die sich über Verfassungen geäußert haben“, so die Kritik des Aristoteles, „wenn sie auch sonst viel Richtiges sagen, verfehlen doch das Nützliche. Denn man darf nicht allein die beste Verfassung betrachten, sondern auch die mögliche, ebenso aber auch die, welche leichter und für alle Staaten erreichbar ist“ (Pol. IV 1,1288b35-39). Aristoteles fragt deshalb: „Was ist die beste Verfassung und was ist die beste Lebensform für die meisten Staaten und für die meisten Menschen?“ (Pol. IV 11,1295a25f.). Vorausgesetzt werden dürfen weder eine Tugend, die über den Durchschnitt hinausgeht, noch eine Bildung, die eine gute Begabung und entsprechende Vermögensverhältnisse erfordert. Voraussetzung ist vielmehr eine Lebensform, an der die meisten Menschen teilnehmen können.
Die Frage nach der unter diesen Voraussetzungen besten Verfassung und die nach der besten Lebensform sind anhand derselben Prinzipien zu beantworten. Aristoteles verweist auf seine Ethik, wo das Glück als „Tätigkeit der Seele entsprechend der Tugend“ (NE I 3 6,1098a16f.) und die Tugend als „Mitte“ (NE II 6,1107a7) bestimmt wird. Es muss also die mittlere Lebensform die beste sein, und zwar das Leben „in einer Mitte, die jeder erreichen kann“. Anhand desselben Kriteriums werden eine gute und eine schlechte Verfassung unterschieden, „denn die Verfassung ist eine Lebensform des Staates“ (Pol. IV 11,1295a38-b1).
„In allen Staaten gibt es drei Teile des Staates: die sehr Reichen, die sehr Armen und als dritten diejenigen, die in der Mitte zwischen diesen liegen“ (Pol. IV 11,1295b1-3). Geht man davon aus, dass die Mitte das Beste ist, dann ergibt sich, dass bei den äußeren Gütern der mittlere Besitz der beste ist, „denn er macht es am leichtesten, der Vernunft zu gehorchen“, während übermäßiger Reichtum und übermäßige Armut es schwer machen. Die Reichen werden übermütig und schlecht im Großen, die Armen werden boshaft und schlecht im Kleinen. Aristoteles hebt hervor, dass der mittlere Besitz die charakterlichen Voraussetzungen für die Ausübung eines politischen Amtes und die Einheit des Staates schafft. Menschen aus dem Mittelstand streben am wenigsten nach Ämtern. Die Reichen wollen und können nicht gehorchen; sie wurden im Elternhaus verzogen und haben nicht einmal ihren Lehrern gehorcht. Arme sind zu unterwürfig; sie können nicht befehlen, sondern nur wie Sklaven gehorchen. So entsteht ein Staat „nicht von Freien, sondern von Herren und Sklaven, wo die einen beneiden und die anderen verachten“ (1295b21-23); dagegen beruht die staatliche Gemeinschaft auf freundschaftlichen Beziehungen. Ein Staat strebt danach, möglichst aus Gleichen zu bestehen; diese Bedingung wird am meisten vom Mittelstand erfüllt. Die Bürger des Mittelstandes leben am sichersten. Sie streben nicht wie die Armen nach fremdem Besitz, noch sind sie wie die Reichen solchen Nachstellungen ausgesetzt, und weil man ihnen nicht nachstellt und sie anderen nicht nachstellen, leben sie sicher.
Die staatliche Gemeinschaft ist die beste, so die abschließende Folgerung, die sich auf den Mittelstand stützt. Im besten Fall ist der Mittelstand stärker als die beiden anderen Teile zusammen, andernfalls sollte er wenigsten stärker sein als einer der beiden Teile, denn dann gibt er dadurch, mit welchem Teil er sich verbindet, den Ausschlag und verhindert so, dass eines der beiden Extreme sich durchsetzt. Als Indiz für die Richtigkeit seiner Überlegungen führt Aristoteles die Tatsache an, dass die besten Gesetzgeber aus dem Mittelstand hervorgegangen sind, so Solon von Athen und Lykurg von Sparta.
Der Begriff der verteilenden Gerechtigkeit hat uns zur Frage nach der besten Verfassung geführt. Unter den Gütern, die zu verteilen sind, nennt Aristoteles an erster Stelle Ehren oder Ämter. Wie die Ämter im Staat zu verteilen sind, regelt die Verfassung. Wann ist die Vertei4 lung der Ämter gerecht? Die verteilende Gerechtigkeit fordert, dass Gleiche Gleiches und Ungleiche Ungleiches erhalten; ein Gut wird zwischen mindestens zwei Personen verteilt, und der Anteil, den jede Person erhält, richtet sich nach deren Würdigkeit (axia). Aber worin besteht die Würdigkeit? Hier beginnt der Streit. Nach den Demokraten besteht sie in der Freiheit, nach den Oligarchen im Reichtum und nach den Aristokraten in der Tugend (NE V 6,1131a14-29). Die Würdigkeit, so die Lösung des Aristoteles, richtet sich nach dem Beitrag, den eine Person zum Ziel des Staates leistet. Ein Staat ist eine Gemeinschaft „zum Zweck eines vollendeten und sich selbst genügenden Lebens, ein solches aber besteht [...] in einem glückseligen und guten Leben. Als eine Gemeinschaft in guten Handlungen müssen wir mithin die staatliche Gemeinschaft bezeichnen [...] Daraus folgt, dass die, welche am meisten zu dieser Art von Gemeinschaft beitragen, einen größeren Anteil am Staat haben als die, welche an freier Geburt oder Abkunft gleich oder überlegen, an der politischen Tugend aber ungleich sind, oder als die, welche an Reichtum überlegen, an Tugend aber unterlegen sind“ (Pol.III 9,1281a1-8), und es ist der Mittelstand, der für die politische Tugend die besten Voraussetzungen mitbringt. Der mittlere Besitz ist der beste. Aber wie ist die richtige Mitte zu bestimmen? Wie wird Besitz in der richtigen Weise und im richtigen Maß erworben?
Aristoteles unterscheidet zwei Arten der Erwerbskunst (ktêtikê). „Die eine Art [...] ist von Natur aus ein Teil der Kunst der Hausverwaltung (oikonomikê)“ (Pol.I 8,1256b26f.). Das „Haus“ (oikia) ist die Gemeinschaft, die den für ihr tägliches Leben erforderlichen Unterhalt erwirtschaftet; sie besteht aus Eltern, Kindern und Sklaven (Pol.I 1,1252b9-15); die Kunst der Hausverwaltung ist „die Herrschaft (archê) über Kinder und Frau und das ganze Haus“ (Pol.III 6.1278b37f.). Die Erwerbskunst, die Teil der Kunst der Hausverwaltung ist, muss dafür sorgen, dass die zum täglichen Leben der Gemeinschaft notwendigen und nützlichen Güter vorhanden sind.
Von dieser „naturgemäßen Erwerbskunst“ (Pol.I 8,1256b37f.) unterscheidet Aristoteles „eine andere Art von Erwerbskunst, die man meistens und mit Recht die Kunst des Gelderwerbs (chrêmatistikê) nennt“. Sie ist nicht naturgemäß, sondern sie kommt „durch Erfahrung und Kunst (technê)“ zustande, und sie ist „schuld an der Meinung, es gebe für Reichtum und Besitz keine Grenze“ (Pol.I 9,1256b40-1257a1).
Jedes Stück Besitz, so beschreibt Aristoteles ihre Entstehung, kann in zweifacher Weise gebraucht werden. So kann man z.B. ein Paar Schuhe tragen oder sie gegen etwas anderes tauschen; der eine Gebrauch entspricht dem Zweck, zu dem die Schuhe hergestellt wurden, 5 der andere nicht; nur dann kann man die Schuhe als Tauschmittel benutzen, wenn sich letztlich jemand findet, der sie tragen möchte. Der natürliche Ursprung des Tauschhandels liegt darin, dass Menschen von dem einen Gut mehr, von dem anderen weniger haben als sie brauchen. In der „ersten Gemeinschaft“, dem „Haus“, braucht es keinen Tausch, denn hier ist alles gemeinsamer Besitz. In der erweiterten Gemeinschaft werden die Güter entsprechend den Bedürfnissen getauscht, „wie es noch viele barbarische Volksstämme tun [...]; sie tauschen Nützliches gegen Nützliches, aber nichts darüber hinaus, z.B. geben und nehmen sie Wein gegen Getreide [...]. Ein solcher Tauschhandel ist weder gegen die Natur noch eine Art der Kunst des Gelderwerbs“ (Pol.I 9,1257a24-29). Weil er jedoch über immer weitere Entfernungen hin stattfand, wurde das Geld eingeführt. „Denn nicht alle von Natur aus notwendigen Güter waren leicht zu transportieren. Deswegen trafen sie für den Tausch untereinander die Übereinkunft, etwas zu geben und zu nehmen, was selbst nützlich ist und sich im Leben leicht handhaben lässt, wie Eisen und Silber und anderes, wenn es diese Eigenschaften besitzt. Sein Wert wurde zunächst einfach nach Größe und Gewicht bestimmt, schließlich schlugen sie auch ein Prägezeichen ein, damit dies das Wiegen überflüssig mache“ (1257a34-41). Nachdem nun das Geld eingeführt war, entstand aus dem Tausch der lebensnotwendigen Güter eine andere Art der Erwerbskunst, der gewerbsmäßige Handel (kapêlikon), zunächst in einfacher Form, dann aufgrund von Erfahrung als ein Fachwissen, wie man beim Umsatz möglichst großen Gewinn machen kann.
Die Kunst des Gelderwerbs macht ein Mittel zum grenzenlosen Ziel. Aller Reichtum hat seine notwendige Grenze, „in Wirklichkeit geschieht aber, wie wir sehen, das Gegenteil: Alle, die sich gewinnbringender Tätigkeit verschreiben, versuchen das Geld bis ins Unendliche zu vermehren“ (Pol.I 9,1257b33f.). Die naturgemäße und die nicht naturgemäße Erwerbskunst kommen darin überein, dass sie beide dieselbe Art von Besitz nutzen, aber sie unterscheiden sich im Zweck. Bei der einen wird der Besitz zu einem von ihm verschiedenen Zweck gebraucht, bei der anderen ist der Zweck die Vermehrung des Besitzes. Die Ursache der zuletzt genannten Zwecksetzung sieht Aristoteles in einer Einstellung zum Leben. Den meisten Menschen geht es nur um das Leben und nicht um das vollkommene Leben, und da ihre Begierde nach Leben ins Unendliche geht, möchten sie, dass auch die Mittel dazu unendlich sind. „Jeder Sinnengenuss hängt am Übermaß, und so suchen sie eine Kunst, die ihnen das Übermaß dieses Genusses verschafft“ (1258a6-8).
Die nicht naturgemäße Erwerbskunst gebraucht den Besitz (ktêsis) als Mittel, um sich 6 selbst zu vermehren, und der so vermehrte Besitz dient wiederum als Mittel zur Sicherung des eigenen Lebens und zur Steigerung des Genusses. Aber ist das der richtige Gebrauch des Besitzes? „Dinge, die einen Gebrauch haben, können gut oder schlecht gebraucht werden. Nun gehört der Reichtum zu den Dingen, die zum Gebrauch da sind. Den besten Gebrauch macht aber derjenige, der die auf das Vermögen (chrêmata) bezogene Tugend hat; das aber ist der Freigebige“ (NE IV 1,1120a4-8). Er wird gelobt für sein Geben und Nehmen von Vermögen. „Vermögen nennen wir alles, dessen Wert durch Geld gemessen wird“ (1119b25f.).
Aristoteles unterscheidet zwischen dem Gebrauch und dem Erwerb des Vermögens. Das Nehmen gehört zum Erwerb, der Gebrauch besteht im Geben. Wer gibt, tut Gutes; wer etwas bekommt, dem wird Gutes getan. Das sittlich gute Handeln besteht darin, dass man Gutes tut, und nicht darin, dass einem Gutes getan wird. Der Freigebige gibt „um des sittlich Guten willen und auf richtige Weise: wem man soll, wie viel man soll und wann, und so für alles, was zum richtigen Geben gehört, und das mit Freude oder doch ohne Bedauern“ (NE IV 2,1120a24-26). Wer mit Bedauern gibt, ist nicht freigebig, „denn er würde das Vermögen der sittlich guten Handlung vorziehen“ (1120a30f.), während es den Freigebigen kennzeichnet, dass die sittlich gute Handlung ihm mehr wert ist als sein Vermögen; „er schätzt das Vermögen nicht um seiner selbst willen, sondern zum Zweck des Gebens“ (1120b16f.). Was nützt der Reichtum, so fragt Aristoteles am Anfang der ersten Abhandlung über die Freundschaft, „wenn man die Wohltätigkeit wegnimmt, die man am meisten gegenüber Freunden ausübt und die dort am meisten gelobt wird“? (NE VIII 1,1155a8f.). Der Freigebige wird seinen eigenen Besitz nicht vernachlässigen. Er unterscheidet sich vom Verschwender, der sich selbst dadurch ruiniert, dass er seinen Besitz ruiniert, von dem sein Leben abhängt. Er erhält seinen Besitz, weil er anderen Menschen damit helfen will; er gibt nicht jedem Beliebigen, „damit er hat, was er denen geben kann, denen man geben soll, und wann man es soll, und wo das Geben sittlich gut ist“ (1120b3f.).
Freigebigkeit schafft soziale Bindungen. Unter denen, die wegen ihrer Tugend geliebt werden, sind es die Freigebigen, die wohl am meisten geliebt werden, „denn sie sind nützlich, und ihre Nützlichkeit liegt im Geben“ (1120a22f.). Wer gibt, dem wird gedankt (1120a15f.). Die Dankbarkeit verlangt, dass Gutes mit Gutem erwidert wird; nur so geschieht ein Austausch, und nur der Austausch verbindet die Menschen. „Denn dies ist dem Dank (charis) eigentümlich: Demjenigen, der einen Gefallen erwiesen hat, muss man im Gegenzug wieder einen Dienst erweisen, und ein andermal muss man als Erster ihm einen Gefallen erweisen“ 7 (NE V 8,1133a4f.). charis bedeutet ‚Dank‘ und ‚Gefallen ‘; die Definition in der Rhetorik lautet: „Ein Gefallen [...] sei eine Hilfeleistung für jemanden, der ihrer bedarf, und nicht als Ausgleich für etwas, und nicht zum Vorteil von dem, der sie leistet, sondern von jenem“ (II 7,1385a17-19).
Der Wohltäter liebt den Empfänger der Wohltat mehr als der Empfänger den Wohltäter. Jeder Künstler liebt sein Werk mehr als das Werk den Künstler lieben würde, wenn es eine Seele hätte, und wer Gutes empfangen hat, ist das Werk dessen, der ihm Gutes getan hat. Jeder liebt sein Werk, weil er sein Sein liebt, denn „was er dem Vermögen nach ist, das zeigt das Werk der Wirklichkeit nach“ (NE IX 7,1168a8f.). Für den Wohltäter ist die Wohltat eine sittlich gute Handlung, so dass er sich an der Person freut, in der diese Handlung verwirklicht wird. Das Empfangen einer Wohltat ist dagegen keine sittlich gute Handlung. Der Empfänger verwirklicht daher im Wohltäter keinen sittlichen Wert; der Wohltäter ist für ihn allenfalls nützlich, und das Nützliche ist weniger liebenswert als das sittlich Gute.
Kehren wir zurück zum Sokrates von Platons Apologie. „Nicht aus dem Reichtum kommt Tugend, sondern aus der Tugend Reichtum und alle anderen Güter, für die einzelnen Menschen wie für die Allgemeinheit.“ In seiner späten Schrift über die Pflichten (De officiis) klagt Cicero, diese Wahrheit sei so sehr in Vergessenheit geraten, dass selbst der Sprachgebrauch vom rechten Weg abgekommen sei, denn nach ihm schließen beide Begriffe einander aus: Sittlich gut ist etwas, was nicht nützlich ist, und nützlich ist etwas, was nicht sittlich gut ist. Diese Verirrung sei „das schlimmste Verderben, das dem Leben der Menschen zugefügt werden konnte“ (II 9). Dagegen stellt Cicero die These: Alles, was gerecht ist, ist nützlich; alles, was sittlich gut ist, ist gerecht; folglich ist alles, was sittlich gut ist, nützlich (II 10). Für seinen Beweis geht Cicero von zwei Tatsachen aus: Es sind die Menschen, die den Menschen am meisten nützen, und es sind die Menschen, die den Menschen am meisten schaden können. Was den Menschen nützt, lässt sich einteilen in unbelebte Dinge wie Gold und Silber, vernunftlose Lebewesen wie Pferde und Rinder und die vernünftigen Wesen: die Götter, die außer Betracht bleiben, und die Menschen; dieselbe Einteilung gilt für das, was den Menschen schaden kann. Dass die unbelebten Dinge und die Tiere dem Menschen nützen, ist zum größten Teil dem Können und der Arbeit der Menschen zu verdanken. Cicero verweist auf den Bergbau, den Bau von Häusern, Wasserleitungen und Häfen, auf die Regulierung von Flüssen und die künstliche Bewässerung, auf die Domestikation von wilden Tieren und die Pflege der Haustiere. „Was soll ich die Menge der Künste aufzählen, ohne die das Leben überhaupt nicht 8 hätte sein können?“ Ohne Vereinigung von Menschen gäbe es keine Städte und folglich keine Rechtsordnung. „Diesen Einrichtungen folgte freundliche Gesinnung und Anstand, und es ergab sich, dass das Leben besser gesichert war und wir durch Geben und Nehmen, durch den Austausch von Mitteln und Vorteilen an nichts Mangel litten“ (II 15). Kein Staatsmann kann ohne die Mitarbeit der Menschen Großes zum Nutzen der Allgemeinheit erreichen.
Die Einmütigkeit und Zusammenarbeit der Menschen ist Ursache der größten Güter, aber ebenso sind Menschen für Menschen Ursache der abscheulichsten Übel. Cicero verweist auf ein Buch des Dikaiarch aus der Schule des Aristoteles über „die Vernichtung von Menschen“ (de interitu homnium). Dikaiarch berichtet, wie viele Menschen durch Überschwemmungen, Seuchen, Verödung von Landstrichen und wilde Tiere umgekommen sind, und er „vergleicht dann, wie viel mehr Menschen durch Gewaltanwendung von Menschen vernichtet wurden, d.h. durch Kriege oder Revolutionen“ (II 16).
Deshalb, so folgert Cicero, ist es „die eigentliche Aufgabe der Tugend, die Herzen der Menschen zu gewinnen und dem eigenen Interesse zu verbinden [...] Der Eifer der Menschen, ihre entschlossene Bereitschaft, unsere Anliegen zu fördern, wird durch die Weisheit und Tugend hervorragender Männer geweckt“ (II 17). Es ist eine der Leistungen der Tugend, dass wir mit den Menschen, „mit denen wir zusammen sind, rücksichtsvoll und verständnisvoll umgehen, so dass wir durch ihr Bemühen das, was die Natur braucht, zur Genüge und reichlich haben, und durch sie, wenn uns ein Nachteil zugefügt wird, ihn abwehren und uns an denen rächen, die versucht haben, uns zu schaden“ (II 18). Es kommt darauf an, die Liebe der Menschen zu gewinnen. Nichts ist mehr geeignet, den eigenen Einfluss zu schützen und zu erhalten, als geliebt zu werden, und nichts ist weniger geeignet, als gefürchtet zu werden. Cicero zitiert den Dichter Ennius (+169 v.Chr.) „«Wen sie fürchten, den hassen sie; wen einer hasst, dem wünscht er den Tod.»“ (II 23). Aber wie ist es möglich, diese Liebe zu gewinnen? Cicero nennt zwei Mittel: durch den Ruhm (gloria) und durch Wohltätigkeit (beneficientia) und Freigebigkeit (liberalitas). Ich beschränke mich auf das zweite.
Es gibt zwei Formen der Wohltätigkeit und Freigebigkeit. Man kann sich persönlich um den anderen bemühen, oder man kann ihm Geld geben. Gemeinsam ist beiden die Absicht, dem anderen Gutes zu tun, aber man tut es in dem einen Fall „aus der Truhe“, in dem anderen „aus der Tüchtigkeit“ (II 52). Cicero lässt keinen Zweifel daran, welche Form der Wohltätigkeit den Vorzug verdient. Die Truhe wird einmal leer; diese Form hebt sich also selbst auf. Es besteht die Gefahr, dass der, welcher gibt, die Truhe dadurch auffüllt, dass er anderen nimmt, 9 was ihnen gehört. Wer so gibt, erzeugt mehr Hass bei denen, welchen er nimmt, als Wohlwollen bei denen, welchen er gibt. Schenken verdirbt den, dem geschenkt wird. „Schenken ist Verderben. Denn wer nimmt, wird schlechter, und immer mehr bereit, dasselbe zu erwarten“ (II 53). Diese Form der Wohltätigkeit, so das abschließende Urteil, ist „im allgemeinen verkehrt, zu gewissen Zeiten notwendig, jedoch selbst dann muss sie den Vermögensverhältnissen angepasst und durch das richtige Maß bestimmt werden“ (II 60). Ausgenommen von dem allgemeinen Verdikt sind die Fälle, in denen ein bestimmter, den Vermögensverhältnisse und der Notlage angemessener Betrag zweckgebunden zur Behebung einer aktuellen Notlage gegeben wird. Beispiele eines solchen richtigen Gebens von Geld, das den Namen Wohltätigkeit und Freigebigkeit verdient, sind: „Gefangene von Seeräubern loskaufen oder Schulden von Freunden übernehmen oder bei der Verheiratung von Töchtern Unterstützung gewähren oder beim Erwerb oder der Vermehrung des Vermögens Hilfe leisten“ (II 55).
Die Truhe wird umso eher leer, je mehr einer daraus schenkt. Wer sich dagegen um den anderen bemüht, d.h. durch Tüchtigkeit und Fleiß wohltätig und großzügig ist, der wird, je mehr Menschen er Gutes getan hat, umso mehr Menschen finden, die ihn in seiner Wohltätigkeit unterstützen. Er wird durch die Gewohnheit immer mehr bereit und immer geübter sein, Gutes zu tun. Aber auch hier gilt es zu unterscheiden. „Anders ist die Lage dessen, der in drückender Not ist, als die eines Mannes, der eine Verbesserung seiner Verhältnisse erstrebt, ohne dass diese unglücklich sind“ (II 61). Gegenüber den vom Unglück Betroffenen muss die Hilfe bereitwilliger sein; bei denen, die ihre Lage verbessern wollen, ist mit Urteil und Sorgfalt auszuwählen. Wer auf diese Weise hilft, verdient Dank. Alle hassen den, der eine Wohltat vergisst; sie sehen in dieser Undankbarkeit auch ein Unrecht, dass sie selbst erleiden, weil dadurch die Freigebigkeit abgeschreckt wird; sie halten den Undankbaren für den gemeinsamen Feind der sozial Schwächeren.
Soll man, wenn es darum geht, einem Menschen zu helfen, auf dessen Charakter oder auf sein Glück schauen? Unser Wille neigt dem vom Glück Begünstigten und Mächtigen zu, denn von ihm ist zu erwarten, dass er unsere Wohltat bald erwidern wird. Doch, so wendet Cicero ein, „die sich für begütert, geehrt, vom Glück gesegnet halten, wünschen gar nicht, durch eine Wohltat verpflichtet zu werden. Sie glauben sogar, selbst eine Wohltat erwiesen zu haben, wenn sie selbst irgendetwas angenommen haben, und vermuten auch, es werde von ihnen etwas gefordert oder erwartet“ (II 69). Dagegen weiß der sozial Schwache, dass man auf ihn und nicht auf sein Glück geschaut hat. Er bemüht sich, seine Dankbarkeit nicht nur dem ge1 0 genüber zu zeigen, der ihm geholfen hat; dass er dankbar ist, soll auch denen deutlich werden, von denen er Hilfe erwartet; auch ihnen wird er also erzählen, was sein Wohltäter für ihn getan hat. Das soziale Echo einer Wohltat, die einem Armen, ist also erheblich stärker als das einer Wohltat, die einem Reichen erwiesen wird. Wer einen Reichen vor Gericht verteidigt, dem sind allenfalls noch dessen Kinder dankbar; wer dagegen einen rechtschaffenen und bescheidenen Armen verteidigt, in dem sehen alle rechtschaffenen einfachen Leute einen Schutz.
Bisher war die Rede von den Wohltaten Einzelner gegen Einzelne; jetzt wendet Cicero sich dem Verhältnis zwischen dem Einzelnen und dem Gemeinwesen (res publica) zu. Er nennt zwei Normen. Die erste lautet: Die Wohltaten für die Einzelnen müssen so bemessen sein, dass sie dem Gemeinwesen nützen oder wenigstens nicht schaden; sein Beispiel sind zwei Getreidespenden. „Die Getreidespende des Gaius Gracchus war zu groß, erschöpfte also die Staatskasse; maßvoll und erträglich für das Gemeinwesen und notwendig für das Volk war die des Marcus Octavius, also segenbringend für Bürger und Gemeinwesen“ (II 72). „Vor allem aber“, so die zweite Norm, „wird der, der das Gemeinwesen verwaltet, sehen müssen, dass jeder das Seine behält und nicht von Staats wegen eine Minderung der Güter von Privatleuten stattfindet [...] Denn vor allem aus dem Grund, dass das Eigentum behalten werden könnte, wurden Gemeinwesen und Staat gegründet“ (II 73). Cicero wendet sich gegen den Vorschlag, der Besitz solle gleichmäßig verteilt werden, und gegen eine Vermögenssteuer, die wegen hoher Kriegskosten erhoben wird. Sollte eine solche Abgabe dennoch einmal unvermeidlich sein, so müsse man sich bemühen, „dass alle einsehen, sie müssten, falls sie in Sicherheit leben wollen, der Notwendigkeit gehorchen“ (II 74). Populisten, die eine Agrarreform in Angriff nehmen, bei der Menschen aus ihrem Eigentum vertrieben werden, oder einen Schuldenerlass fordern, „erschüttern die Fundamente des Gemeinwesens“ (II 78): die Eintracht, die nicht bestehen kann, wenn Geld den einen weggenommen und den anderen geschenkt wird; die Gerechtigkeit, die beseitigt wird, wenn nicht jeder das Seine behalten darf; das Vertrauen, das nicht mehr möglich ist, wenn man geliehenes Geld nicht zurückzuzahlen braucht.
Vertretungsberechtigte Personen
Paul Widmer
Ladanyi-Verein
c/o Ruth Wiederkehr
Äusseren Grundstrasse 16
CH-8910 Affoltern am Albis
Telefon: +41 79 844 90 38
ein E-Mail
senden

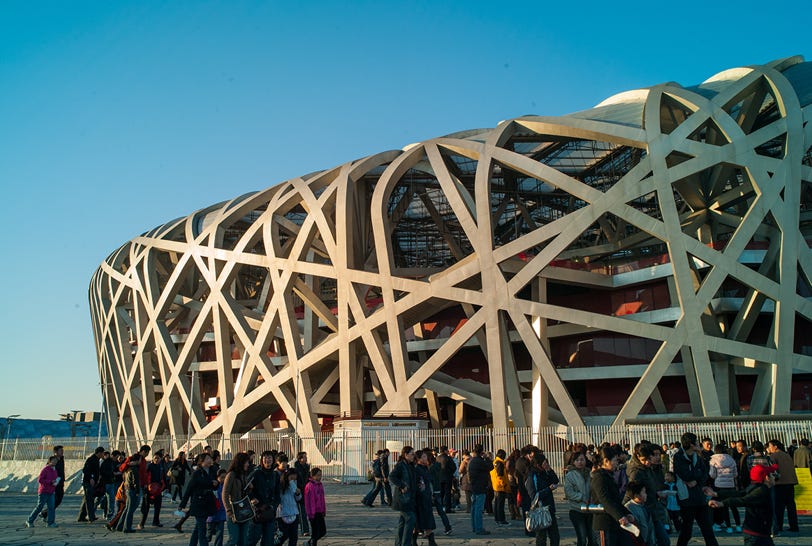
Fotos:
Klaus Pichler, www.pichlerphoto.ch
designed by
Diese Seite wird neu überarbeitet.
Schauen Sie später wieder rein.
Kontaktformular
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.
Setzt ein technisches Cookie, das Ihre Ablehnung der Zustimmung aufzeichnet, Sie werden nicht erneut gefragt.


